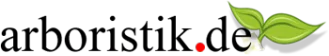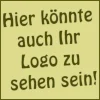Wenn Eichen und Kiefern der Kahlfraß droht

Mit Massenvermehrungen des Eichenprozessionsspinners muss im Zuge des Klimawandels hierzulande häufiger gerechnet werden. Derartige Kalamitäten führen nicht nur zur Schwächung von Eichenbeständen, die Larven der Schmetterlingsart Thaumetopoea processionea L können mit ihren Brennhaaren bei Menschen und Tieren allergische und toxische Reaktionen auslösen. Foto: Katrin Möller
(5.10.2024) Massenvermehrungen bestimmter Insektenarten können durch Kahlfraß – gerade in trockenheitsgefährdeten Eichen- und Kiefernwäldern – erhebliche Schäden verursachen. Der Einsatz von Pflanzenschutzmitteln ist allerdings trotz Schädlingsmonitoring und Risikoabwägung umstritten. Im Forschungsvorhaben „Artemis“, gefördert durch das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL), haben Forschende Werkzeuge für ein anpassungsfähiges Risikomanagement entwickelt, das Waldschutz-Informationen liefert und die Forstpraxis bei Monitoring, Prognose sowie Entscheidungen für oder gegen einen Pflanzenschutzeinsatz unterstützt.
Das Landeskompetenzzentrum Forst Eberswalde, die Landesforstanstalt Mecklenburg-Vorpommern, die Bayerische Landesanstalt für Wald und Forstwirtschaft, die Forstliche Versuchs- und Forschungsanstalt Baden-Württemberg und die agrathaer GmbH starteten das Forschungsvorhaben „Artemis“ ↗ 2019 mit dem Ziel, ein adaptives Risikomanagement in trockenheitsgefährdeten Eichen- und Kiefernwäldern mit Hilfe integrativer Bewertung und angepasster Schadschwellen zu entwickeln.
Dazu analysierten sie historische Schadereignisse, katalogisierten länderübergreifende Daten in einer Geodatenbank, ermittelten in Umfragen und Interviews mit Betroffenen ein umfassendes Meinungsbild zu Waldschutz sowie Pflanzenschutzmitteleinsatz und erarbeiteten in Expertenworkshops Beispiellösungen. Neben regionalen Klimadaten wurden auch Möglichkeiten der Fernerkundung einbezogen.
Schwerpunkt war eine intensive Literaturrecherche, mit der die Entscheidung für oder gegen Pflanzenschutzmaßnahmen, also für oder gegen Kahlfraß, im Hinblick auf die Waldökosystemleistungen analysiert wurden. Anhand der artspezifischen Auswirkungen blatt- und nadelfressender Insekten wurden die Voraussetzungen geschaffen, Schadschwellen differenzierter festlegen zu können.

Abgestorbene Kiefern - nach Kahlfraß durch Kiefernspinnerraupen und folgendem Borkenkäferbefall fehlt der schützende Altbaum-Schirm. Das erschwert eine Verjüngung des Bestands, da viele Baumarten auf ein intaktes Waldklima angewiesen sind. Foto: Frank Pastowski
Webtool als Entscheidungshilfe
Im Ergebnis liegt nun ein Webtool vor, das fachlich fundiert und detailliert mögliche Konsequenzen eines Pflanzenschutzmitteleinsatzes bzw. -verzichts aufzeigt und so nachvollziehbare und schlüssige Entscheidungen fördert. Das „Artemis“-Webtool, das zudem den sachlichen Diskurs zum Einsatz von Pflanzenschutzmitteln im Forst befördert, steht auf der Projektwebseite ↗ zur Verfügung.
Daneben entwickelte das Projektkonsortium zwei neue Waldschutzverfahren, die in Bayern bereits in die Praxis überführt wurden: ein sechsstufiges Eichen-Vitalitätsmonitoring vom Einzelbaum bis zum Gesamtbestand sowie ein Fitnessmonitoring für Schwammspinnerpopulationen ab dem Kulminationspunkt einer Massenvermehrung. Zudem wurde das in Großbritannien am akuten Eichensterben beteiligte Bakterium Brenneria goodwinii erstmals in Bayern nachgewiesen. Die Ergebnisse werden derzeit verifiziert. Genetische Untersuchungen unterstützen überdies die These, dass für das seit ca. 1990 verstärkte Auftreten des Eichenprozessionsspinners in Deutschland klimatische Faktoren ausschlaggebend sind und nicht die Einwanderung oder Einschleppung aus Österreich, Frankreich oder den Niederlanden.
Zur Prävention von Massenvermehrungen des Kiefernspanners empfehlen die Projetbeteiligten die Herstellung einer geeigneten Krautschicht und die Beimischung von Laubbaumarten. Außerdem wurde die Schadschwelle für den Kiefernspanner bei der Winterbodensuche angepasst.
Zudem wurde ein automatisiertes Tool zur Erkennung von Blattverlusten in Laubwäldern anhand von Sentinel-2-Daten erstellt, um den Waldzustand in Vorjahren ohne Freilandaufnahmen zu beurteilen. Multispektrale Sentinel-2-Daten erleichtern dabei die Detektion von mittleren bis starken Nadelverlusten an Kiefern. Zur Modellierung des Nadelverlusts eignen sich LiDAR-Daten aufgrund ihrer effizienteren Prozessierung besser als Hyperspektraldaten.
Aus Sicht der Forschenden ist im Übrigen der aktuelle Rahmen des Pflanzenschutzrechts mit Aussparung der Waldränder bei der Behandlung nicht ausreichend, um Eichenwälder vor teils massiven Schäden zu bewahren. Noch im Jahr der Maßnahme kann eine Wiederbesiedelung der gesamten Waldfläche vom unbehandelten Rand her erfolgen.
Hintergrund
Massenvermehrungen von blatt- und nadelfressenden Insekten – darunter Eichenprozessionsspinner, Schwammspinner und Eichenwickler ebenso wie Kiefernspinner, Nonne und Kiefernbuschhornblattwespen – führen zu Kalamitäten mit erheblichen Auswirkungen. Insbesondere durch Trockenheit geschwächte Waldbestände können absterben. Dies hat auch Auswirkungen auf die vielfältigen Waldfunktionen. Beispielsweise kann es durch den selektiven Befall bestimmter Arten zu einer Verschiebung in der Baumartenzusammensetzung und zur Abnahme der Biodiversität kommen. Neben sinkender CO2-Speicherung, Holzverfügbarkeit, Wasserspeicher- und Erosionsschutzfunktion führt das Absterben von Beständen zur Veränderung des Landschaftsbildes mit negativen Folgen für Erholung und Tourismus.
(Dr. Torsten Gabriel, FNR)