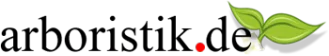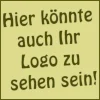Gitterroste nicht nur an Birnen
(30.5.2019) Allgemein bekannt ist der Birnengitterrost, der sich im Laufe der Jahre zu einer gefährlichen Krankheit an Birnen im Haus- und Kleingarten entwickelt hat. Ähnliche Schadsymptome treten auch von Verwandten des Birnengitterrosts an Crataegus- und Sorbus-Arten auf. Sie sind zwar örtlich sehr auffällig, haben aber noch nicht das Schadausmaß des Birnengitterrosts erreicht.
Birnengitterrost - Gymnosporangium sabinae
Auf den jungen Birnenblättern erscheinen im Frühjahr zunächst nur sehr kleine, orangerote Flecke, die spätezusammenfließen. Anfangs werden diese Symptome leicht übersehen. Aufmerksam wird man erst im Spätsommer oder Herbst auf die großen orangeroten Flecke am Birnenlaub. In diesen Flecken sind dunkle, klebrige Punkte zu finden. Das sind die Fruchtkörper des Pilzes, die für die weitere Vermehrung von Bedeutung sind. Der pilzliche Erreger des Birnengitterrosts wächst dann im Spätsommer auch zur Blattunterseite durch.
Hier entstehen auffällige, körbchenförmige, gitterartige, 3 Millimeter aus dem Blattgewebe herausragende Sporenlager. Die dort gebildeten Sporen infizieren noch im Herbst verschiedene Wacholder-Arten. Dort überwintert der Pilz dann auch.
Birnengitterrost - Gymnosporangium sabinae
Auf den jungen Birnenblättern erscheinen im Frühjahr zunächst nur sehr kleine, orangerote Flecke, die spätezusammenfließen. Anfangs werden diese Symptome leicht übersehen. Aufmerksam wird man erst im Spätsommer oder Herbst auf die großen orangeroten Flecke am Birnenlaub. In diesen Flecken sind dunkle, klebrige Punkte zu finden. Das sind die Fruchtkörper des Pilzes, die für die weitere Vermehrung von Bedeutung sind. Der pilzliche Erreger des Birnengitterrosts wächst dann im Spätsommer auch zur Blattunterseite durch.
Hier entstehen auffällige, körbchenförmige, gitterartige, 3 Millimeter aus dem Blattgewebe herausragende Sporenlager. Die dort gebildeten Sporen infizieren noch im Herbst verschiedene Wacholder-Arten. Dort überwintert der Pilz dann auch.
Von den Wacholder-Arten werden Juniperus sabina, J. chinensis, J. oxycedrus, J. phoenicea und J. virginiana befallen. Der Gemeine Wacholder (Juniperus communis) ist kein Wirt des Birnengitterrosts. Befallene Wacholderzweige schwellen an den Infektionsstellen oft keulenförmig an. Im Frühjahr treten aus diesen Zweigen besonders bei Regenperioden bräunliche oder hellorangefarbene, längliche, warzige, gelatineartige Zapfen, ebenfalls Fruchtkörper des Erregers, hervor. Hier werden die Wintersporen des Pilzes gebildet, die dann wieder zur Birne zurückkehren. Die Fruchtkörper schrumpfen bei trockenem Wetter ein und können über längere Zeit an den Zweigen erhalten bleiben. Der Erreger ist in der Lage, mehrere Jahre auf dem Wacholder zu überdauern.
Der Rostpilz führt zu sehr auffälligen Symptomen. Eine Schädigung der Birnen ist dann zu erwarten, wenn mehr als die Hälfte der Blattfläche betroffen ist und sich ein über mehrere Jahre andauernd starker Befall zeigt. Nicht nur die Kulturbirne, sondern auch Pyrus-Arten, die unter anderem als Ziergehölze verwendet werden, können von diesem Rost befallen werden. Nach Untersuchungen an der Humboldt-Universität zu Berlin, bei der 16 Pyrus-Wildarten beziehungsweise - Hybriden mehrere Jahre hinsichtlich ihrer Anfälligkeit gegenüber dem Birnengitterrost beobachtet wurden, hatte Pyrus korzhinskyi den geringsten Befall. Pyrus betulifolia, P. cordata und P. salicifolia var. ’Pendula‘ zeigten nur unwesentliche Schadsymptome.
Abhilfe: Um einen Wirtswechsel des pilzlichen Erregers vom Wacholder zur Birne zu erschweren, sollten in der Nähe von Birnen die betreffenden Wacholder-Arten möglichst nicht gepflanzt werden. Dabei sollte der Abstand mindestens 500 Meter betragen. Es wird aber auch von Infektionsmöglichkeiten aus einer Entfernung von 1 Kilometer berichtet. Befallenes Birnenlaub kann kompostiert werden, wenn es gleich mit Erde bedeckt wird. Die Sporen gehen hier mit der Verrottung zugrunde. Die Pflanzen können mit Pflanzenstärkungsmitteln vitalisiert werden. Direkte Behandlungen sind mit zugelassenen Präparaten möglich. Beim Wacholder empfiehlt es sich, keulig angeschwollene, langjährig befallene Zweige zu entfernen und zu vernichten.
Weißdorngitterrost - Gymnosporangium clavariiforme
Auf Weiß- und Rotdornblättern bilden sich zunächst ab Mitte Mai bis 5 Millimeter große, orangefarbene Flecken. Im weiteren Entwicklungsverlauf des pilzlichen Erregers entstehen an Trieben, Blattstielen, Blättern, Blüten-, Fruchtständen und Früchten bis zu 1 Zentimeter große verdickte, teils rötlich verfärbte Abschnitte mit warzenartigen Sporenlagern.
Dieser Rostpilz macht einen Wirtswechsel zu Juniperus communis, einer Wacholder-Art, die vom Birnengitterrost nicht befallen wird. Im Frühjahr treten aus den angeschwollenen Wacholder-Zweigen ab Mitte April anfangs braune, später gelblich-orange erscheinende, 1 bis 2 cm große, gallertartige Sporenlager hervor. Im Herbst infizieren die auf den Sommerwirten gebildeten Pilzsporen wieder den Wacholder. Während das Myzel des Erregers mehrere Jahre auf dem Wacholder überdauern kann, müssen die Sommerwirte jährlich neu infiziert werden. Zu den Sommerwirten zählen außer Crataegus- seltener auch Amelanchier-Arten.
Abhilfe: Wo möglich, sollte auf eine räumliche Trennung zwischen den Sommerwirten und dem Wacholder geachtet werden. Da die Sporen über große Entfernungen fliegen können, ist mit dieser Maßnahme kein absoluter Erfolg garantiert. Sie kann aber zu einer Minderung des Befallsdrucks beitragen. Dies ist insofern von Bedeutung, da in den letzten Jahren eine Befallszunahme zu beobachten war. Im Frühjahr sollte der Wacholder regelmäßig überwacht werden, um angeschwollene Zweige oder, bei erstem Hervorquellen der Fruchtkörper, die betroffenen Partien sofort herauszuschneiden und zu vernichten. Auch der Schnitt befallener Weißdorntriebe kann sinnvoll sein. Bei jahrelang wiederholtem starkem Befall an den Sommerwirten kann eine Behandlung mit zugelassenen Fungiziden erforderlich werden. Geringer Befall wird meist toleriert.
Weißdorngitterrost - Gymnosporangium clavariiforme
Auf Weiß- und Rotdornblättern bilden sich zunächst ab Mitte Mai bis 5 Millimeter große, orangefarbene Flecken. Im weiteren Entwicklungsverlauf des pilzlichen Erregers entstehen an Trieben, Blattstielen, Blättern, Blüten-, Fruchtständen und Früchten bis zu 1 Zentimeter große verdickte, teils rötlich verfärbte Abschnitte mit warzenartigen Sporenlagern.
Dieser Rostpilz macht einen Wirtswechsel zu Juniperus communis, einer Wacholder-Art, die vom Birnengitterrost nicht befallen wird. Im Frühjahr treten aus den angeschwollenen Wacholder-Zweigen ab Mitte April anfangs braune, später gelblich-orange erscheinende, 1 bis 2 cm große, gallertartige Sporenlager hervor. Im Herbst infizieren die auf den Sommerwirten gebildeten Pilzsporen wieder den Wacholder. Während das Myzel des Erregers mehrere Jahre auf dem Wacholder überdauern kann, müssen die Sommerwirte jährlich neu infiziert werden. Zu den Sommerwirten zählen außer Crataegus- seltener auch Amelanchier-Arten.
Abhilfe: Wo möglich, sollte auf eine räumliche Trennung zwischen den Sommerwirten und dem Wacholder geachtet werden. Da die Sporen über große Entfernungen fliegen können, ist mit dieser Maßnahme kein absoluter Erfolg garantiert. Sie kann aber zu einer Minderung des Befallsdrucks beitragen. Dies ist insofern von Bedeutung, da in den letzten Jahren eine Befallszunahme zu beobachten war. Im Frühjahr sollte der Wacholder regelmäßig überwacht werden, um angeschwollene Zweige oder, bei erstem Hervorquellen der Fruchtkörper, die betroffenen Partien sofort herauszuschneiden und zu vernichten. Auch der Schnitt befallener Weißdorntriebe kann sinnvoll sein. Bei jahrelang wiederholtem starkem Befall an den Sommerwirten kann eine Behandlung mit zugelassenen Fungiziden erforderlich werden. Geringer Befall wird meist toleriert.
Ebereschenrost - Gymnosporangium juniperinum f. sp. aucupariae (G. cornutum)
Durch den Ebereschenrost werden auf den Blättern leuchtend orange bis gelbe Flecke gebildet. In diesem Bereich sind unterseits 3 bis 5 Millimeter lange, hornartige Fruchtkörper zu finden, die am Ende pinselartig zerschlitzt sind.
Ein Befall ist auch an Früchten möglich. Der pilzliche Erreger infiziert vornehmlich Sorbus aucuparia, seltener S. aria. Er ist wirtswechselnd mit Juniperus-Arten und bildet dort auf angeschwollenen Ästen seine Wintersporenlager. Ähnliche Symptome werden von weiteren Gymnosporangium-Erregern hervorgerufen.
Abhilfe: Soweit es in Anpflanzungen möglich ist, sollte die Nähe von Wacholder-Arten und Ebereschen gemieden werden. Eine direkte Bekämpfung war bislang nicht erforderlich. Ansonsten können zugelassene Präparate angewendet werden.
(Quelle: IVA-Magazin / iva.de)
(Quelle: IVA-Magazin / iva.de)
Bildnachweise:
Gymnosporangium sabinae, Birnengitterrost. Foto: Fritz Geller-Grimm, Gymnosporangium sabinae, CC BY-SA 2.5
Gitterrost (Gymnosporangium sabinae) an Wacholder. Foto: Eco-mus, Gymnosporangium sabinae, CC BY-SA 3.0
Gymnosporangium an Weißdorn. Foto: Velella, G clavarifore Belgian-Promenade, CC BY-SA 3.0
Sporenlager des Weißdorngitterrostes am Wacholder. Foto: Velella, Gymnosporangum telia emerging from Juniperus, CC BY-SA 3.0
Rostflecken auf Ebereschenblättern. Foto: Liné1, Sorbus aucuparia leaves 01 by Line1, CC BY-SA 3.0