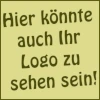Rostpilze: Wirtswechsel verbreitet

(11.8.2025) Im Reich der Pilze gibt es viele parasitisch lebende Arten, die einen breiten Wirtspflanzenkreis haben, das heißt sehr viele unterschiedliche Gattungen und Arten von Pflanzen infizieren können, die nicht unbedingt miteinander verwandt sein müssen. Andere Pilzarten sind spezialisiert und parasitieren nur eine Gattung oder sogar nur eine Art.
Eine faszinierende und recht stark spezialisierte Ordnung sind die Rostpilze (Pucciniales, syn. Uredinales). Viele von ihnen leben nur auf Wirten einer einzigen Gattung oder Art, so zum Beispiel Phragmidium mucronatum an Rose, Cumminsiella mirabilissima an Mahonie, Phragmidium rubi-idaei an Himbeere und Melampsora hypericorum an Johannisstrauch. Eine Besonderheit der Rostpilze ist allerdings, dass einige von ihnen wirtswechselnd leben, das heißt von einer Pflanzenart auf eine völlig andere, nicht oder nur sehr entfernt verwandte Art wechseln und auf diesen Wechsel auch angewiesen sind. Auf einer Art allein können sie also nicht dauerhaft überleben.
Wirtspflanzen
Relativ bekannte wirtswechselnde Rostpilze sind der Johannisbeersäulenrost Cronartium ribicola, der vom Laub Schwarzer Johannisbeeren auf Triebe fünfnadeliger Kiefern-Arten wandert, dort als Weymouthskiefernblasenrost mehrere Jahre bestehen kann und wieder Blätter der Schwarzen Johannisbeeren infiziert.

Unterseite eines mit Säulenrost befallenen Johannisbeerblatts. Foto: Marek Argent, Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0
Ein ähnlicher Wechsel findet beim Birnengitterrost Gymnosporangium sabinae syn. Gymnosporangium fuscum von Blättern der Birnbäume zu den Trieben der Wacholderarten Juniperus virginiana, J. sabina und J. chinensis statt. Daneben tritt an Birnbäumen sowie vor allem an Weißdorn auch Gymnosporangium clavariiforme auf, der auf den Gemeinen Wacholder Juniperus communis wechselt.

An den Zweigen des Wacholders Juniperus communis können sich viele Jahre lang jedes Frühjahr die Fruchtkörper bestimmter Rostpilze bilden, bevor die befallenen Zweigpartien absterben. Foto: Volker Croy, Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0
Gymnosporangium juniperinum an Ebereschen hat ebenfalls Juniperus communis als Zwischenwirt. Verschiedene andere Rostpilze wechseln von Weiden, Erlen und Birken auf die Europäische Lärche Larix decidua und führen dort zu Nadelfall. Aber auch Wirtswechsel von Gehölzen zu krautartigen Pflanzen sind bekannt, so zum Beispiel der Weißtannen-Säulenrost Pucciniastrum epilobii zwischen Nadeln verschiedener Arten der Tanne (Abies spp.) und des Weidenröschens (Epilobium spp.) sowie beim Getreide-Schwarzrost (Puccinia graminis) von Sauerdorn (Berberis spp.) zu Gräsern (auch Getreide).
Unterschiedliche Sporenformen
Dieser Wechsel hängt mit dem außerordentlich komplizierten Entwicklungszyklus der Rostpilze zusammen, die bis zu fünf unterschiedliche Sporenformen in Folge aufeinander bilden können und deren jeweilige Sporenform dann auf bestimmte Pflanzenarten spezialisiert ist. Oft sind die Fruchtkörper auffällig gelb, orange oder rot gefärbt (daher der Name "Rostpilze"), manchmal aber auch weiß, bräunlich oder schwarz. Meist bilden sie auf den Blättern kleine Flecke, an Trieben aber auch oft auffällige gallertartige, größere Fruchtkörper.

Birnengitterrost wechselt vom Laub der Birnbäume auf die Zweige der Wacholderarten Juniperus virginiana. J. sabina und J. chinensis. Foto: Fritz Geller-Grimm, Wikimedia Commons, CC BY-SA 2.5
Zwischenwirte beseitigen?
Um Infektionen an wertvollen Pflanzen zu verhindern, wird oft empfohlen, weiträumig den Zwischenwirt zu vernichten. Das ist zwar theoretisch richtig, aber da die Sporen von Rostpilzen wie die vieler anderer pilzlicher Krankheitserreger vom Wind über sehr weite Strecken transportiert werden können, bringt ein solches Entfernen der Zwischenwirte nicht immer den erhofften Erfolg. Wo es problemlos umsetzbar ist, zum Beispiel beim Entfernen von Weidenröschen aus Weihnachtsbaumquartieren mit Nordmanntannen, ist es natürlich durchaus zu empfehlen, weil dadurch der Befallsdruck gesenkt wird, aber gerade bei Birnengitterrost oder Johannisbeersäulenrost in Siedlungsgebieten mit vielfältiger Bepflanzung ist eine solche Maßnahme schwer durchsetzbar. Vielmehr sollten möglichst widerstandsfähige Sorten gepflanzt werden. Bei Rosen gibt es gegenüber dem (nicht wirtswechselnden) Rost erhebliche Unterschiede in der Anfälligkeit, aber bei Birnen und Johannisbeeren scheinen die Unterschiede deutlich geringer zu sein.
Weitere Gegenmaßnahmen
Befallenes Laub von Rosen oder Himbeeren sollte im Winter aus dem Garten entfernt werden, weil sich daran Überdauerungsorgane der Rostpilze leben. Bei Birnen und Johannisbeeren ist das nicht der Fall. Da Rostpilze zur Infektion eine gewisse Blattfeuchte brauchen, ist es günstig, die Pflanzen möglichst trocken zu halten, zum Beispiel indem man einen Birnbaum in Spalierform an einer Hauswand unter dem Dachüberstand anzieht.
(Quelle: IVA-Magazin / iva.de)