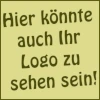Gelber Rasen muss nicht sein - Stadtgärten in Zeiten des Klimawandels

Foto: Petra Faltermaier auf Pixabay
(15.7.2023) Die vergangenen heißen und trockenen Sommer haben auch Privatgärten stark zugesetzt. Gelbe Rasenflächen, hängende Blätter an Büschen und vertrocknete Beete machen Gartenbesitzer*innen zu schaffen. Doch wenn sie ihren Garten klimaresilient gestalten und richtig bewässern, profitieren Gärtner*innen nicht nur selbst von sattem Grün, sondern die Pflanzen tragen durch ihre Verdunstung sogar für eine leichte Kühlung des überhitzen Stadtklimas bei. Pflanzenforscher Norbert Kühn gibt im Interview Tipps, wie Gärten und Balkone an den Klimawandel angepasst werden können.
Sie leiten seit 2003 das Fachgebiet Vegetationstechnik und Pflanzenverwendung an der TU Berlin. Wie steht es denn um den privaten Stadtgarten in Zeiten des Klimawandels?
Stadtgärten sind sowohl für die privaten Nutzer*innen und auch für die Stadt und das Stadtklima eine wichtige Ausgleichsfläche, weil dort unversiegelter Boden ist, dort Bäume stehen und es Schatten gibt. Privatgärten in Städten sind deshalb so wichtig, weil sie auch bei trockenen Phasen gewässert werden, die Pflanzen dadurch verdunsten können und so eine gewisse Kühlung erzeugen. Das ist bei städtischen Parks anders, da geht die Verdunstung von Bäumen und Rasenflächen bei fehlender Bodenfeuchte zurück.
Wie machen die Bäume und Pflanzen das?
Es gibt Tricks, die die Pflanzen auf Lager haben, um bei Stress durch Hitze und Trockenheit ihre Verdunstung zu reduzieren und sich vor Überhitzung zu schützen. Die Silberlinden z.B. dreht die stark behaarte, weiß glänzende Unterseite ihrer Blätter nach oben, sodass sie die Sonnenstrahlen reflektieren. Die Platane hat die Möglichkeit, braune Teile der Borke abzutrennen, sodass nur noch die silbern-weißliche Borke übrig bleibt. Auch sie reflektiert die Sonnenstrahlen besser und wirkt so einer Überhitzung des Stammes entgegen. Andere Bäume lassen die Blätter hängen und werfen einen Teil davon ab. In den letzten Trockenjahren waren Bäume gezwungen mit noch massiveren Maßnahmen zu reagieren und ganze Äste abzuwerfen. Dadurch mussten Parks zeitweise sogar gesperrt werden. Rasen wird bei Trockenstress braun und stirbt oberirdisch ab. Auch wenn Stauden und kleinere Gehölze braun werden und die Blätter verlieren, ist die Verdunstung sehr stark eingeschränkt. Im privaten Garten kann man in diesen Phasen wässern. Das hilft, die Verdunstung auf einem gewissen Niveau zu halten.
Wie können Privatgärtner*innen denn ihren Garten klimaresilienter gestalten?
Es gibt ein paar Grundsätze, die man bei der Gartenplanung beachten sollte. Zum einen sollte man den Boden so wenig wie möglich versiegeln, sodass man viel Fläche hat, wo Wasser versickern kann und der natürliche Wasserkreislauf gewährleistet ist. Asphalt sollte man ganz meiden und Plattenbeläge für Terrasse und Wege muss man nicht unbedingt verfugen. Und wenn man das Dach- oder Garagenwasser im eigenen Garten versickern lässt, spart das auf die Dauer bei der Abwasserrechnung und trägt zur Grundwasserneubildung bei. Wenn der Garten groß genug ist, ist es ideal, wenn man schattige Plätze mit Bäumen hat, aber auch freie Plätze wo die Sonne zwar eindringt, wo aber auch die Wärme nachts abstrahlen kann.
Welche trockenheitsresilienten Bäume sollten Gartenbesitzer*innen neu pflanzen, wenn sie den Garten vor Sonne und Hitze schützt wollen?
Sehr gut geeignet sind in der Regel Bäume, die aus dem submediterranen Bereich kommen wie die Felsenbirne, die Manna-Esche, die Elsbeere oder der Goldregen. Es gibt auch kleinere Bäume wie die Hopfenbuche, den Burgen-Ahorn oder den italienischen Ahorn. Interessanter Weise sind auch die meisten Obstbäume relativ hitzetolerant. Der herkömmliche Brandenburger Boden ist meist sandig und durchlässig, was solche Trockenperioden noch verstärkt und da empfehlen sich auf jeden Fall trockenheitsangepasste Baum- oder Straucharten.
Was sollte man bei der Pflege nach dem Pflanzen beachten?
Zu Anfangs, bis sie sich etabliert haben, müssen Bäume in den ersten zwei bis drei Jahren gut gegossen werden: Bei der Pflanzung den Ballen gut feucht machen und wenn sie im Pflanzloch stehen mit 10-20 Gießkannen angießen. Damit das Wasser nicht gleich abfließt, sollte man einen guten Gießring anlegen, einen kleinen Erdwall rings um die Pflanze, damit das Gießwasser nicht sofort wieder abfließt und direkt zu den Wurzeln gelangt.
Wie sieht denn ein gutes Gießverhalten aus?
Bei großen Bäumen macht es wenig Sinn den Boden mit technischen Mitteln wie der Tröpfchenbewässerung dauerfeucht zu halten. Besser ist, die Pflanzen bei Trockenperioden ordentlich zu gießen und dann den Boden auch wieder austrocknen zu lassen – bis zur nächsten größeren Wassergabe. Denn die Wurzeln des Baumes brauchen nicht nur Wasser sondern auch Luft und es ist wichtig, dass die Poren im Boden auch wieder frei werden, damit Luft eindringen kann. In den immer häufiger vorkommenden Hitzefrühjahren, wo es schon sehr früh ab April, Mai trocken und heiß wird, sollte man junge Bäume, die zu diesem Zeitpunkt austreiben und dann sehr viel Wasser brauchen, kräftig gießen, damit sie einen guten Wachstumsstart haben. Auch wenn der Nachbar ein bisschen komisch guckt – das bringt wesentlich mehr als im August, wo die Wachstumsphase und auch die Blüten- und Fruchtphase in der Regel vorbei sind und wo ein Baum sich etwas an die Trockenheit anpassen kann und auch mal seine Blätter hängen lässt.

Norbert Kühn in den Schaugärten der TU Berlin. Foto: Norbert Kühn

Der Goldregen bildet im Mai und Juni unzählige Schmetterlingsblüten aus. Foto: Norbert Kühn
Da fällt mir ein, letzten Spätsommer habe ich in Berlin Kastanienbäume gesehen, die keine Blätter mehr hatten aber an einigen Stellen geblüht haben. Hat das auch was mit der Trockenheit zu tun?
Das ist bei Rosskastanien ein bekanntes Phänomen, dass sie ein zweites Mal austreiben, wenn sie extrem gestresst sind und die Blätter komplett verloren haben. Kastanien sind nicht die idealen Stadtbäume. Die Kastanienminiermotte macht ihnen zu schaffen und sie sind sehr salzunverträglich. Wenn dann noch Trocken- und Hitzephasen dazukommen kann es sein, dass sie schon Ende August kahl da stehen. Und wenn sie dann austreiben, müssen sie erneut blühen, weil die Blüten schon in den Knospen angelegt sind. Der Baum geht dann nicht unbedingt kaputt, aber es ist nicht gut für ihn, weil er dann auch wieder zum Abschluss kommen muss, um den Winter zu überleben.
Welche Pflanzen sind besonders trockenheitsverträglich und welche kommen auch mit Starkregen zurecht?
Man kann auf hitzetolerante Stauden achten. Bei guten Gärtnereien findet man z.B. Angaben zu den geeigneten Lebensbereichen. Pflanzen der sogenannten „Trockene Freifläche“ funktionieren besonders gut bei Hitze und Trockenheit. Stauden die grau sind, also eine stark behaarte Oberfläche besitzen, sind meist auch besonders hitzetolerant. Das gleiche gilt für Pflanzen mit ätherischen Ölen wie Lavendel, Oregano, Salbei, Thymian u. a., die meist auch eine sehr tiefe Wurzel haben. Wenn Pflanzen aus mediterranen Gegenden, aus der Prärie oder aus der Steppe kommen, dann hat man gute Chancen, dass sie auch hitze- und trockenheitsverträglich sind. Am schwierigsten sind Standorte zu bepflanzen, die schattig und trocken sind, weil das gleich zwei Stressfaktoren für die Pflanzen sind. Da kann man dann z.B. auf Sauergräser der Gattungen Luzula oder Carex zurückgreifen.
Machen tatsächlich die ätherischen Öle einige Pflanzen so trockenheitsresistent?
Das ist nicht so ganz klar. Es ist aber auffällig, dass diese Pflanzen während großer Trockenheit sehr stark Öle produzieren – wahrscheinlich ist das auch ein Oberflächen- und Austrocknungsschutz. Ganz extrem macht es das Diptam, der brennende Busch, eine heimische Pflanze an trockenen, heißen Gehölzrändern. Ihr Öl kann man an heißen Tagen sogar anzünden. Man muss aber vorsichtig sein, weil die ganze Pflanze phototoxisch ist. Wenn man sie berührt, kann es sein, dass man bei anschließendem Lichtgenuss verstärkten Ausschlag kriegt. Eine schöne Pflanze aber nichts für den Privatgarten mit Kindern.

Die Kugeldistel mit ihren blauen Blütenkugeln gehört zu den trockenheitsverträglichen Pflanzen. Foto: Norbert Kühn

Präriepflanzungen an der TU Berlin. Foto: Norbert Kühn
Vermehrt treten in den letzten Jahren auch Starkregenereignisse auf. Wie kann man damit im Privatgarten umgehen?
Ich würge beobachten, wo fließt der Regen hin, wie sieht der Wasserfluss in meinem Garten aus. Und dann wäre es spannend im Garten eine Retentionsfläche zu schaffen. Das ist eine Mulde, ein tieferer Bereich, der Wasser aufnehmen kann und einen so durchlässigen Boden hat, dass das Wasser dort versickern kann. Das ist in unserem üblichen Brandenburger Boden kein Problem. Stauden wechselfeuchter Standorte können in diesen Mulden wachsen und dann hat man ein schönes Beet, was ein bisschen naturgemäßer aussieht. In einem unserer Forschungsprojekt zu Versickerungsmulden in der Stadt haben wir einige schöne Pflanzen, die gut funktionieren im Wechsel von Trockenheit und kurzzeitiger Überflutung. Zum Beispiel blüht gerade eine Edeldistel ganz wunderbar darin und auch die Steppeniris oder die Steppenwolfsmilch funktionieren gut. Ein paar Gräser wie das Pfeifengras kommen ebenfalls mit zeitweisen Überschwemmungen zurecht.

Forschungsvorhaben Versickerungsmulden in Rummelsburg. Foto: Norbert Kühn
Häufig ist der Gartenboden durch Trockenheitsperioden derart ausgetrocknet, dass starker Regen einfach abfließt und die Pflanzen im Boden gar nicht erst erreicht. Wie kann man den Gartenboden auf große Trockenheitsperioden und dann plötzlich auftretenden Starkregen optimal vorbereiten?
Was sehr gut hilft, ist mit Kompost zu arbeiten der die Oberbodenschicht auflockert und auch Verschlämmungen entgegenwirkt, sodass das Wasser besser eindringen kann, aber auch aus Erdspalten nicht so schnell wieder verdunstet. Kompost bringt auch organische Stoffe in den Boden und ist so ein wichtiger Teil im Gartenkreislauf. Man kann auch mulchen. Wenn man eine Pflanzung runterschneidet, sollte man den Mulch belassen, der dann durch die entsprechenden Bodenlebewesen eingearbeitet wird. Oder ich kann ihn kompostieren und dann den Kompost aufbringen. Für kleinere Gärten ist die zweite Variante die bessere Methode, weil grober Mulch Mäuse und Ratten anzieht, die in der Stadt allgegenwärtig sind.
Also Kompost ist schon mal das A und O! Wie sieht es denn mit Rasenflächen im Garten aus? Ein Lieblingsthema bei Gärtner*innen, der ja aber auch in zunehmend heißeren Sommern ein echter Problemfall wird.
Rasen ist wichtig, denn man kann dort Dinge machen, die man woanders nicht machen kann, wie Ballspielen, drauf liegen oder ihn betreten. Man sollte gut überlegen, wie viel Rasen man tatsächlich braucht. Wenn Rasen viel genutzt wird, muss man ihn intensiv düngen, wässern und schneiden. Duldet man ein paar Rasenunkräuter wie den Löwenzahn oder den Ehrenpreis, dann wird er artenreicher und man kann ihn trotzdem nutzen. Und wer einige Bereiche auf dem Rasen nicht betreten muss, kann dort eine Wiese anlegen, die für viele Pflanzen und Tiere interessant ist.
Wie legt man so eine Wiese im Garten an?
Die Wiesenarten sollten im Herbst in die vorher oberflächlich aufgelockerte Rasennarbe eingesät werden. Danach streut man Sand drüber und gießt an. Über den Winter haben die Pflanzen dann eine gute Chance zu keimen und sich zu etablieren. Der Vorteil so einer Wiese sind die schönen Blühaspekte wie vom Salbei oder der Margerite. Die Wiese ist auch viel pflegeleichter, weil man sie nur 2-3 mal im Jahr mähen und nur im ersten oder zweiten Jahr gießen muss. Ich wässere meine Wiesen gar nicht und da macht es auch nichts, wenn die Wiese mal ein bisschen strohig aussieht. Das gehört dazu und dann kommen auch die trockenheitsverträglichen Arten besser zum Vorschein. Es bietet sich auch an, eine Wiese mit Rasenwegen zu durchschneiden. Das sieht sehr schön aus, weil man im Vordergrund den grünen Rasenteppich hat und dahinter die hohe Struktur der Gräser, die ein bisschen naturalistischer aussieht, das kann einen sehr schönen Kontrast bilden und eine ästhetische Qualität besitzen.

Prärie-Wildblumen. Foto: AlisonJames auf Pixabay
Sie haben auch zu Präriepflanzungen in Deutschland publiziert. Was zeichnet einen Präriegarten aus und ist er auch eine Alternative in Zeiten des Klimawandels?
Die Prärie ist ein riesiges Ökosystem in Nordamerika und dadurch gekennzeichnet, dass sie sehr tiefwurzelnde Pflanzen hat. Die Steppe hier bei uns in Europa und Asien funktioniert ähnlich. Es kann dort sehr heiß und trocken werden im Sommer und die Pflanzen können auch gut mit Starkregen umgehen. Es gibt sehr schön blühende Pflanzen dort mit teils ungewöhnlichen Farben, weil es in Nordamerika Kolibris und Schmetterlinge gibt, die andere Farben brauchen. Wir hatten hier z.B. eine Seidenpflanze mit einem knalligen Orange. Im privaten Garten würde ich zu einer Mischgrasprärie raten, die wird nicht ganz so hoch und sie muss nur einmal im Jahr im Winter gemäht werden.
Haben Sie noch Tipps für Menschen, die keinen Garten haben, dafür aber ihren Balkon begrünen wollen?
Man kann einen trockenheitsverträglichen Balkon mit mediterranen Kräutern wie Lavendel, Rosmarin oder Gewürzsalbei bepflanzen. Die sind alle einigermaßen hitze- und trockenverträglich und auch für Insekten interessant. So ein Balkon ist recht pflegearm. Ansonsten würde ich empfehlen, einen möglichst üppigen Balkon mit vielen Pflanzen anzulegen. Auch hier entsteht – im Kleinen natürlich – Schatten und Verdunstung. Wenn man auf Insekten wert legt, sollte man auf insektenaffine Pflanzen achten und zum Beispiel Geranien und gefüllte Pflanzen meiden, wo wenig Pollenangebot da ist. Aber sogar Petunien können für Nachtfalter interessant sein.

Balkonbepflanzung. Foto: MichiKep auf Pixabay
Konnten Sie schon klimatische Anpassungen bzw. Veränderungen bei Pflanzen und oder Bäumen beobachten?
Wir können beobachten, dass Nadelgehölze wie die Fichte oder die Lärche oder Laubgehölze wie die Birke aus der borealen Zone bei uns nicht mehr gut funktionieren. Die mögen es einfach kühler, frischer und feuchter. Einige Laubgehölze aus dem mediterranen, submediterranen Raum hingegen funktionieren hier jetzt so gut, dass sie sich spontan ausbreiten. Einige, wie der Götterbaum, gelten schon als invasiv. Das ist ein super Stadtbaum, weil er unglaublich gut Hitze aushalten kann. Auch der Blauglockenbaum oder die Blasenesche, unglaublich schön blühende Bäume, sind sehr klimaresistent und breitet sich aus. In Berlin breitet sich seit kurzem der Burgen-Ahorn spontan aus. Das sich solche Bäume in den Städten zunehmend wohl fühlen, könnte ein guter Hinweis für den beginnenden Klimawandel sein.
Sind invasive Arten denn bedrohlich?
Viele denken, diese Arten beeinträchtigen die Diversität der natürlichen Pflanzen. Ich sehe das Thema nicht ganz so kritisch. Das Problem ist eher, das viele der natürlichen Pflanzen im Klimawandel nicht erhalten bleiben. Es gibt Untersuchungen, dass wir in Berlin Brandenburg ein Arten-Turnover, also einen Pflanzenaustausch, von 40-70 Prozent haben werden. Und wenn da nicht auch was dazu kommt, dann haben wir ein Problem. Viele dieser invasiven Pflanzen legen erstmal los und dann nischen sie sich auch ein, ihre Konkurrenzkraft lässt nach, wenn beispielsweise der entsprechende Schädling oder Krankheiten mit eingeführt werden.
Von ihrer Forschung zu Bewässerungsmulden in der Stadt haben Sie schon erzählt. Was sind Ihre nächsten Forschungsvorhaben?
Beim nächsten Forschungsvorhaben, und ich hoffe wir bekommen da noch die Förderung, wollen wir in Tegel Verdunstungsbeete anlegen. Das ist ein Teil der Idee der Schwammstadt. Diese Beete sind unten abgedichtet und das kann man sich vorstellen wie eine große Badewanne, wo das Wasser bei Regenereignissen reinfließt und sich dort ansammelt. Steigt das Wasser zu hoch an, gibt es auch einen Notabfluss. Etwas ähnliches ist ein abgedichtetes Sumpfbeet im Garten, wo man auch das Regenwasser hinleiten kann. Idealerweise sollte man dort mit verdichtetem Ton oder Lehm anstatt mit Plastikwannen oder Beton arbeiten. In Tegel möchte man das Regenwasser deshalb speichern, weil es dort kontaminierten Boden gibt. Nur an bestimmten Stellen, wo der Boden freigeräumt wurde, darf das Wasser versickern. Das Speichern des Wassers hat den Vorteil, dass es den Pflanzen in den Beeten zur Verfügung steht und über die Verdunstung abgebaut werden kann, deswegen heißen sie auch Verdunstungsbeete. Dazu gibt es bisher wenig Forschung in Mitteleuropa und im Zusammenhang mit dem Schumacherquartier in Tegel wollen wir diese Verdunstungsbeete erforschen. Hier gibt es auch ein großes Interesse der Stadt und der Wasserbetriebe. Wir wollen auch weiter in Richtung historische Gärten forschen und schauen, wie sie schon in der Vergangenheit klimagerecht bewirtschaftet und gepflegt worden sind.
(Das Interview führte Barbara Halstenberg, TU Berlin)