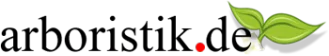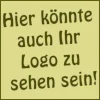FraxForFuture legt Ergebnisse vor: Hoffnung auf Rettung der Esche besteht zurecht

Foto: Alejandro Piñero Amerio auf Pixabay
(6.5.2025) Das 2024 beendete Forschungsvorhaben FraxForFuture ↗ rechtfertigt die Hoffnung auf den Erhalt der bestandsbedrohten Baumart Gemeine Esche (Fraxinus excelsior). In dem bundesweit bisher einmaligen Demonstrationsvorhaben hatten sechs Forschungsverbünde fachübergreifend und eng verzahnt mit der Forstpraxis zum Eschentriebsterben und zum Erhalt der Baumart geforscht. Die FNR ↗stellt jetzt in einem Beitrag in ihrer Rubrik Wissenswertes ausgewählte Forschungsergebnisse vor.
Und sie wächst doch: Zumindest ein Teil der in Europa heimischen Eschen (Fraxinus excelsior) ist imstande, dem Erreger des Eschentriebsterbens (ETS) bislang zu trotzen. Mit gezielter waldbaulicher und wissenschaftlicher Unterstützung soll die ökologisch und wirtschaftlich bedeutsame Esche in Deutschland erhalten und stabilisiert, resilienter Eschennachwuchs etabliert und die Ausbreitung des ETS-Erregers aufgehalten werden.

Im Forschungsvorhaben FraxForFuture wurden Lösungen zum Erhalt der bestandsgefährdeten Gemeinen Esche (Fraxinus excelsior) entwickelt. Foto: Pixabay/Binael
Seit 2020 hatten sechs Forschungsverbünde mit mehr als 70 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern bundesweit am Monitoring des von dem invasiven Schlauchpilz Falsches Weißes Stängelbecherchen (Hymenoscyphus fraxineus) verursachten Eschentriebsterbens, an der Genetik und Pathologie von Esche und Erreger sowie an der Eindämmung der Erkrankung und Züchtung widerstandsfähiger Eschennachkommen gearbeitet. Ausgewählte Ergebnisse des interdisziplinären Demonstationsvorhabens FraxForFuture sind auf wald.fnr.de ↗ in einem Beitrag der Rubrik Wissenswertes nachzulesen.

Esche mit vitaler Krone. Die Baumart ist bundes- und europaweit vom Eschentriebsterben bedroht. Foto: NW-FVA

Das Endstadium der Eschenerkrankung: Gänzlich fehlender Blattaustrieb im Sommer. Der Baum ist abgestorben. Foto: NW-FVA
Ergebnisse der sechs Forscherteams im Überblick
So könnte der ETS-Erreger Hymenoscyphus fraxineus eingedämmt werden:
Biologische Kontrolle/ nicht-chemische Bekämpfung:
Priming: Vorbehandlung bedrohter Jung-Eschen mit Eschen-Endophyten (Organismen aus dem Mikrobiom resilienter Eschen) oder Vorinfektion bedrohter Jung-Eschen mit schwach virulenten Isolaten des ETS-Erregers
Mikrobiomoptimierung: Besprühen bzw. Inokulieren von Eschensämlingen mit ETS-Antagonisten oder gesundheitsfördernden Organismen (Pilzen und Bakterien), die aus gesundem Eschen-Mikrobiom isoliert wurden
Hypovirulenz: Bekämpfung des ETS-Erregers H. fraxineus mit aus Eschenendophyten isolierten Viren, die durch Produktion wachstumshemmender Substanzen die Virulenz von H. fraxineus verringern
RNAi: Besprühen junger Eschen mit RNA-interferierten Substanzen (natürlicher Bestandteil des pflanzlichen Abwehrsystems), die lebenswichtige Gene im ETS-Erreger H. fraxineus stilllegen
Einsatz antagonistisch wirkender Bakterienstämme aus gesunden Eschenblättern zur Verdrängung und Wachstumshemmung des ETS-Erregers H. fraxineus
Für die Forstpraxis sind entstanden:
Samenplantagen mit Nachkommen resilienter Eschen
Intensivbeobachtungsflächen zur Winter- und Sommerbonitur von Eschen bundesweit als Basis für ein kontinuierliches Monitoring von Eschenbeständen
Praxis-Handbuch: Boniturschlüssel ↗ zur Erfassung der Schadsymptomatik an Eschen
Online-Tools zur Analyse der monetären und nicht-monetären Folgen des ETS für betriebswirtschaftliche Entscheidungen im Umgang mit geschädigten Beständen
Praxisschulungen
Online-Broschüre „Zukunft der Esche“ ↗mit waldbaulichen Empfehlungen für den Umgang mit geschädigten Eschenbeständen
Für weitere Forschung und zur Entwicklung praxisreifer Verfahren liegen vor:
• Histologische und dendrochronologische Untersuchungen zum ETS-Verlauf mit Triebsterben und Stammfußnekrosen auf zellulärer und biochemischer Ebene, an Einzelbäumen und im gesamten Bestand
• Phäno- und Genotypisierung resilienter Eschen zur Bereitstellung resilienten Vermehrungsguts
• Im Projekt etablierte In-vitro-Verfahren und Kryokonservierung zur Einlagerung und Vermehrung resilienter Esche-Genotypen
• Verfahren zur biologischen Kontrolle des ETS-Erregers H. fraxineus und zur Optimierung des Eschenmikrobioms gegenüber dem Pathogen
• Auf gesunden Eschenblättern erstmals nachgewiesene antifungal und antibiotisch wirkende Bakterienstämme, z. B. Schauerella fraxinea, zur nicht chemischen Bekämpfung des ETS-Erregers H. fraxineus
• Genetische Untersuchungen zu den Abwehrmechanismen resilienter und nicht resilienter Eschen
• Erkenntnisse zu genetischen Resistenzmarkern
• Mehr als 30 wissenschaftliche Veröffentlichungen zu Fragestellungen des Eschentriebsterbens
Hintergrund:
Auslöser für die Eschentriebsterben-Epidemie ist der in Ostasien beheimatete Schlauchpilz Hymenoscyphus fraxineus. In den 1990er-Jahren möglicherweise durch infiziertes Pflanzgut nach Europa eingetragen, breitete sich H. Fraxineus ab 2002 rasant in Deutschland aus.
Im Juli 2020 startete das aus 31 Teilvorhaben bestehende Demonstrationsprojekt FraxForFuture mit dem Ziel, praktikable Lösungen zum Erhalt der ökologisch und wirtschaftlich bedeutsamen Esche zu entwickeln und waldbauliche Empfehlungen für die Praxis vorzulegen.
Das Demonstrationsvorhaben war von 2020 bis 2024 mit rund 10 Millionen Euro aus dem gemeinschaftlichen Waldklimafonds der Bundesministerien für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL) und für Umwelt, Naturschutz nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz (BMUV) über die Fachagentur Nachwachsende Rohstoffe (FNR) gefördert worden. Die weitere Finanzierung des Waldklimafonds wurde 2024 eingestellt; Anschlussforschung und Praxistransfer der Ergebnisse wurden damit deutlich erschwert.
(Martina Plothe, FNR)