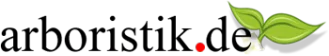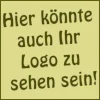Die Robinie, eine nicht unumstrittene Baumart
(2.11.2019) Die Stiftung "Baum des Jahres" hat am 24.10.2019 die Robinie als Baum des Jahres 2020 ausgerufen. Mit ihrer üppigen Blütenpracht ist die Robinie nicht zu übersehen. Im Frühsommer leuchten ihre Kronen wie große weiße Wattebäusche an Waldrändern, Feldgehölzen und in Ortschaften. Doch so schön sie ist: die Robinie ist nicht unumstritten. Wir haben den Präsidenten der Bayerischen Landesanstalt für Wald und Forstwirtschaft (LWF) und ausgewiesenen Baumexperten Olaf Schmidt zur Robinie als neuem Baum des Jahres befragt.
Vor über 300 Jahren wurde die Robinie in Mitteleuropa eingeführt. Sie ist eine Meisterin im Besiedeln der unwirtlichsten Lebensräume, sie hat ein extrem haltbares Holz und ist eine wertvolle und ausgiebige Bienenweide. Für die einen ist sie eine zukunftssichere Baumart im Klimawandel, für die anderen ein invasiver Neophyt, der Naturkleinode bedroht.
Wir haben den Präsidenten der Bayerischen Landesanstalt für Wald und Forstwirtschaft (LWF) und ausgewiesenen BauBaumexperten Olaf Schmidt zur Robinie als neuem Baum des Jahres befragt. Die aktuelle Neuerscheinung ↗"Trau! Schau! Wem? - Nichtheimische Baumarten in der Forstwirtschaft" von LWF-aktuell liefert eine kritische Analyse zu Chancen und Risiken dieser Baumarten für die Stabilisierung unserer Wälder im Klimawandel.
Sehr geehrter Herr Schmidt: Hat sie die Auswahl der Robinie als Baum des Jahres überrascht?
Olaf Schmidt: Nein, eigentlich war ich nicht überrascht, denn es standen drei Kandidaten zur Auswahl, Kornelkirsche, Silberpappel und Robinie, und da habe ich schon mit der Robinie gerechnet. Kornelkirsche ist keine Baumart, auch wenn es einzelne, alte baumförmige Kornelkirschen gibt, und die Silberpappel ist eine Auwaldbaumart, ähnlich wie die Flatterulme als Baum des Jahres 2019.
Robinie – was fällt Ihnen dazu als Erstes ein?
Akazienhonig – die Robinie ist eine hervorragende Bienenweide und wurde daher auch aktiv von Imkern verbreitet.

Robinie am Ortseingang. Foto: Johann Seidl

Robinie mit Marterl. Foto: Johann Seidl
Wie der wissenschaftliche Name Robinia pseudoacacia oder auch
Scheinakazie nahelegt, gibt es Ähnlichkeiten zur südländischen Akazie.
Welche sind das?
Die Robinie besitzt fein gefiederte Blätter und manchmal auch eine
abgeflachte Kronenform, so dass sie gewisse äußere Ähnlichkeiten mit
den echten Akazien aufweist. Die Akazien sind aber Baumarten aus den
Subtropen und Tropen. Die Heimat der Robinie liegt im östlichen
Nordamerika.
Was schätzen Sie als Förster an der Robinie
Ich schätze vor allem das sehr haltbare, dauerhafte Holz der
Robinie. Es ist auch ohne Holzschutzmittel im Freien sehr dauerhaft, so
dass es zum Beispiel für Gartenmöbel genutzt werden kann. Man spricht
auch wegen seiner Haltbarkeit vom “Teak des Nordens”. In der
Schutzwaldverbauung in den Alpen und bei Spielgeräten auf Spielplätzen spielt die Verwendung von Holz der Robinie eine große
Rolle. Der Kern ist auffällig grünlich gefärbt. Bei der Bearbeitung des
Robinienholzes müssen die Arbeitsschutzvorschriften eingehalten werden,
da der Holzstaub der Robinie aufgrund der vielfältigen Inhaltsstoffe
allergene Wirkung zeigen kann.
Welche ökologische Bedeutung hat die Robinie darüber hinaus?
Bei uns ist die Robinie ja nicht heimisch, aber unsere
blütenbesuchenden Insekten, wie die Honigbiene, aber auch andere
Insekten, wie zum Beispiel Schwebfliegen, lieben die Blüten der Robinie.
Die Robinie blüht circa 2 Wochen so Ende Mai/Anfang Juni, sie ist
hervorragender Nektarspender. Ihr Nektar enthält viel Fruktose und
bleibt daher lange flüssig. Die weißen, duftenden Blüten sind eine wahre
Augenweide und in Städten, Parks, Grünanlagen, an Waldrändern ist die
Robinie ein ornamentaler Schmuckbaum.
Gibt es in Deutschland größere mehr oder minder reine Robinien-Waldbestände?
In Mitteleuropa gibt es die größten Robinien-Bestände in Ungarn,
die dort fast 1/4 der gesamten ungarischen Waldfläche einnehmen. In
Deutschland stocken Robinien-Bestände vor allem in Brandenburg, Sachsen
und Rheinland-Pfalz. In Bayern wurde sie vor allem auf den sandigen
Standorte vor allem im Regnitz-Gebiet um Nürnberg und Bamberg, forstlich
angebaut. In der freien Landschaft sieht man Robinien häufig an
Bahndämmen, auf Ruderalstandorten; in Sachsen und Brandenburg hat sie
Bedeutung bei der Aufforstung von Bergbaufolgelandschaften bzw. von Halden.
Die Robinie hat als Pflanze in bestimmten Bereichen einen
deutlich invasiven Charakter. Sehen sie eine Bedrohung durch die Robine?
Die Robinie ist vom Verhalten her eine Pionierbaumart mit
schnellem Jugendwachstum, frühzeitiger Fruktifikation, reicher
Wurzelbrut und als Leguminose mit stickstoffsammelnden Bakterien an den
Wurzeln. Diese Eigenschaften können zu einem invasivem Eindringen der Robinie in
naturschutzfachlich wertvolle Biotope, zum Beispiel Trockenrasen und
Magerstandorte führen. Durch ihr leicht zersetzliches Laub und durch
ihre stickstoffsammelnden Wurzelbakterien kann sie Standorte verändern und eutrophieren.
Es treten dann nitrophile Pflanzen, wie zum Beispiel Holunder,
Brennnessel häufiger auf. Ein invasives Eindringen in Laubmischwälder
auf mittleren und besseren Standorten ist nicht zu erwarten. Man muss
die Ansprüche der Baumart kennen, dann kann man auch mit dieser Baumart
umgehen. Meine Auffassung ist es sowieso, dass Baumarten die
Biodiversität nicht bedrohen.
Woher kommt die Robinie und wann wurde sie nach Europa eingeführt?
Die Robinie stammt aus dem östlichen Nordamerika und sie wurde
schon als eine der ersten amerikanischen Baumarten nach Europa im
17.Jahrhundert eingeführt. Ihr Name soll auf den französischen Botaniker
Robin zurückgehen.
Besitzt die Robinie als Baumart bei uns Feinde bzw. Schaderreger?
Ja, an der Robinie treten vor allem als parasitische Holzpilze der
Eschenbaumschwamm und der Schwefelporling auf. Unterdessen haben auch
zwei Miniermotten an der Robinie und eine Gallmücke den Weg von ihrem
Heimatgebiet nach Europa gefunden. Sie bedrohen aber die Robinie nicht.
Vom Schalenwild und vom Weidevieh wird das eiweißreiche Laub der Robinie
gerne gefressen. Die Rinde der Robinie ist aber giftig. Für Menschen
sind alle Teile der Pflanze ungenießbar und schädlich.
Zum Schluss: Welcher der jetzt inzwischen 32 Bäume des Jahres ist ihr persönlicher Favorit?
Als Forstmann gefallen mir eigentlich alle Baumarten! Ich bin ja
auch dendrologisch sehr interessiert! Aber wenn ich einen Favoriten
nennen soll, dann ist es für mich die Vogelbeere! Diese Baumart
begleitet mich seit meiner Kindheit und ich freue mich als Vogelfreund
über den Besuch verschiedenster Vogelarten an der Vogelbeere, um dort
die Beeren zu fressen.
Und welche Baumart würden Sie gerne nächste Jahr als Baum des Jahres nominiert sehen und warum?
Nun sind ja schon fast alle unserer Baumarten einmal Baum des
Jahres gewesen. Wir besitzen ja in Mitteleuropa nur eine relativ kleine
Baumartenanzahl. Aus waldökologischen Gründen würde ich mich über die
Gemeine Traubenkirsche (Prunus padus) oder die Salweide (Salix caprea)
als Baum des Jahres freuen.
Vielen Dank Herr Schmidt für das aufschlussreiche Interview!
(Das Interview führte Johann Seidl, LWF)
Weitere Informationen: